Bericht
von der Jahrestagung 2025 in Bad Herrenalb
Albert Schweitzer
- Mythos und Wirklichkeit
Zur Rezeption in Vergangenheit und Gegenwart.
Bericht von der Jahrestagung des Bundes
von Dr. Kurt Bangert
Die diesjährige Jahrestagung des Bundes für Freies Christentum fand vom 19. bis 21. September in der Evangelischen Akademie Baden im schönen Bad Herrenalb statt. Das Thema lautete: „Albert Schweitzer: Mythos und Wirklichkeit. Zur Rezeption in Vergangenheit und Gegenwart.“
Anlass der Tagung waren das 150. Jubiläum von Schweitzers Geburtstag am 14. Januar 1875 und sein 60. Todestag am 4. September 1965. Die diesjährige Tagung sollte ergründen, wie Albert Schweitzer rezipiert wurde: in der deutschen Öffentlichkeit, in Philosophie und Theologie sowie auch vom Bund für Freies Christentum. Es waren mehr als 40 Teilnehmer anwesend.
Der Studienleiter der Evangelischen Akademie, Pfarrer Peter Schock, hieß alle Teilnehmer willkommen und stellte u.a. die Frage, warum Schweitzer trotz seiner immer noch großen Aktualität so selten zu Rate gezogen werde. Schock gab das Motto der Tagung vor, indem er Schweitzers berühmten Satz zitierte: „Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.“
Prof. Dr. Werner Zager, Präsident des Bundes, führte konkret in das Thema ein und verwies auf einen Brief Schweitzers, der sich 1927 – als er mit 52 Jahren in einem Konfirmandenbuch oftmals zitiert wurde – sich über diese verfrühte Ehre beschwerte. „Ihr habt einen halben Kirchenvater aus mir gemacht. Da bekommt man Angst vor seinen Schwächen“, klagte Schweitzer. Zager stellte auch den Bund für Freies Christentum sowie die Referentin des Abends vor.
Dr. Caroline Fetscher, Redakteurin beim Berliner Tagesspiegel, befasste sich mit der Entwicklung und Bedeutung Albert Schweitzers als eines Mythos im bundesrepublikanischen Westen nach 1945. Schweitzer war durch seine Arbeit als „Urwalddoktor“ sowie durch seine Bücher – darunter seine Autobiographie – bereits gut bekannt gewesen. Die Tragödie des Zweiten Weltkriegs, der für viele zu Schuldgefühlen, Ressentiment und Rachegefühlen geführt hatte, ließ die Deutschen nach Orientierung für ihre Nachkriegssituation suchen. In dieser Lage sei Schweitzer zu einer beliebten Lichtgestalt in einem noch anhaltenden Trauerspiel geworden, so die Referentin.
„Du bist der einzige Erwachsene, dem ich vertraue“, schrieb ein Schüler, der beispielhaft zitiert wurde für die vielen jungen Menschen, denen Schweitzer nach dem Krieg so etwas wie ein Vaterersatz wurde. Er war der Mann der guten Tat. Und wenn eine Mutter ihren Kindern aus seinen Büchern vorlas, so „sind wir alle bessere Menschen“, resümierte ein anderer Schüler. Schweitzer landete nicht nur auf dem Titel des Spiegel-Magazins, sondern auch des Time-Magazins („The Greatest Man in the World“). Rund 200 deutsche Schulen wurden nach ihm benannt.
Sein Engagement gegen die Atombombe und die Verleihung des Friedensnobelpreises machten ihn dann endgültig zu einem deutschen Mythos. Ob er selbst zu diesem Mythos beigetragen hat? Das wird man nicht ganz ausschließen können. Jedenfalls bemühte er sich immer wieder darum, seine Philosophie der „Ehrfurcht vor dem Leben“ unter die Leute zu bringen.
In seiner Samstagmorgen-Andacht zog Pfarrer Ingo Zöllich, Vorstandsmitglied des Bundes, eine gewagte Parallele zwischen König David und Albert Schweitzer. Beiden seien zahlreiche Zitate angedichtet worden. Was war es an Schweitzer, dass er die Menschen immer wieder inspirierte, ihm wertvolle Gedanken zuzuschreiben? Die weiteren Vorträge sollten auf diesen Mythos Antworten geben.
Hatte sich Dr. Caroline Fetscher mit der Resonanz Schweitzers in der Bundesrepublik Deutschland befasst, so beleuchtete Dr. Wolfgang Pfüller, wie der „Urwalddoktor“ in der damaligen DDR aufgenommen wurde. Schweitzer genoss dort hohes Ansehen, insbesondere weil er sich gegen die Atombombe und für den Frieden engagierte. Vor allem die Ost-CDU sowie mehrere Albert-Schweitzer-Freundeskreise stellten Schweitzer als beispielhafte Persönlichkeit dar. Als Protagonisten Schweitzers sind vor allem zu nennen der Ost-CDU-Vorsitzende Gerald Götting, Pfarrer Rudolf Grabs sowie Karl Sensenschmidt und Gottfried Schwär, die ihrerseits mehrere Freundeskreise ins Leben riefen. Götting sorgte sogar dafür, dass in Weimar ein Denkmal Schweitzers aufgestellt wurde.
Für Götting war Schweitzer ein großer Kulturphilosoph und Humanist, ein Pionier der Menschlichkeit, ein vorbildlicher Christ und ein väterlicher Freund. Götting gab auch ein Büchlein Schweitzers mit dem Titel „Die Lehre von der Ehrfurcht vor dem Leben“ heraus, durch das Schweitzer in der DDR recht populär wurde. Was man an Schweitzer vor allem schätzte, war die Übereinstimmung zwischen Wort und Tat in seinem Leben. Dass Schweitzer ein unerschütterlicher Kämpfer für den Frieden war, kam nicht nur der Ost-CDU, sondern auch den Verantwortlichen der DDR-Regierung gelegen. Insoweit ist er denn auch ein Stück weit politisch instrumentalisiert worden. An Karl Sensenschmidt schrieb Schweitzer: „Helfen Sie mit, das Werk der Ehrfurcht vor dem Leben zu verbreiten.“ Sensenschmidt nahm den Brief zum Anlass, seinen eigenen Freundeskreis zu gründen.
Im nächsten Vortrag versuchte der Philosoph und Pädagoge Dr. Michael Großmann, der auch zum Vorstand des Bundes gehört, zu ergründen, ob Schweitzer „ein von der akademischen Philosophie verkannter Denker“ war. Schweitzer verstand sich ja in erster Linie als Philosoph, der sich u.a. von Kant, Schopenhauer und Goethe hatte inspirieren lassen. Aber den fachphilosophischen Diskussionen konnte er nur wenig abgewinnen. Seine weltweite Wirkung außerhalb der akademischen Sphäre dürfte seiner Anerkennung im universitären Milieu durchaus hinderlich gewesen sein. Wenn er von Philosophen überhaupt erwähnt wurde, dann meist kritisch bis ablehnend. In den philosophischen Lexika sucht man ihn in der Regel vergebens.
Trotz der Zurückhaltung vieler Philosophen in Bezug auf Schweitzer gab es aber kaum Zweifel an seiner fachlichen Qualifikation; seine philosophische Dissertation wurde immer wieder als „Meisterwerk“ bezeichnet. Aber weitere philosophische Werke verfasste Schweitzer nicht, sieht man von seiner Kulturphilosophie ab, die ja auch einen religiösen Einschlag hatte. Eine positive Würdigung erfuhr Schweitzer indes von den Philosophen Hans-Walter Bähr, Eduard Spranger und Ernst Cassirer. Gewiss war Schweitzer nicht in die Reihe der regulären Philosophen einzureihen, zumal, wenn er überhaupt mit anderen Philosophen korrespondierte, dann mit solchen, die – wie er selbst – philosophische Grenzgänger waren: etwa mit Bertrand Russell, Martin Buber, Werner Jaeger und Karl Jaspers.
Großmann vermutet, Schweitzer habe zu verständlich gesprochen und geschrieben und keine philosophische Fachsprache benutzt, um von den Philosophen seiner Zeit ernst genommen zu werden. Er redete auch gerne – anders als die meisten Philosophen – in lebhaften Bildern und Gleichnissen. Zudem wurde Schweitzers Irrationalität und Mystik kritisch gesehen. Schwierigkeiten bereiteten den Philosophen auch Schweitzers Lebens- und Kulturbegriff. Problematisch erschien ihnen sodann die Absolutheit von Schweitzers Ehrfurchtsethik. Schweitzer: „Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben erkennt keine relative Ethik an.“ Für ihn waren alle Erscheinungen des Lebens prinzipiell gleichwertig. Damit taten sich die Philosophen jedoch schwer.
Gleichwohl sei Schweitzer philosophisch noch lange nicht „erledigt“, so Großmann. Gerade im Hinblick auf moderne naturwissenschaftliche und philosophische Paradigmen sei Schweitzer anschlussfähig. Auch als Grundlegung moralischen Denkens bleibe Schweitzer relevant. Auf der Basis seiner Ehrfurchtsethik könne auch eine Verantwortungs- und Werteethik entwickelt werden. Er wurde auch für die Öko- bzw. Umweltschutzbewegung zur Inspiration. Zum Schluss verglich Großmann Schweitzers Kulturphilosophie mit einer noch im Bau befindlichen Kathedrale: „Der Grundstein ist gelegt, der Chor ist gemauert. Aber es sind noch große Arbeiten nötig, die Generationen beschäftigen werden.“
Der anschließende Vortrag am Samstagnachmittag von Dr. Raphael Zager behandelte Schweitzers Rolle als Theologe. War er ein Außenseiter im theologischen Wissenschaftsbetrieb? Zweifellos blieb seine Wirkung innerhalb der Theologie begrenzt. Das lag zum einen daran, dass er sich von der Theologie abwandte und Mediziner wurde. Auch wurden seine theologischen Ansätze von der Fachwelt anfangs kaum aufgegriffen. Zudem wurde er von der Dialektischen Theologie sehr kritisch gesehen. Karl Barth meinte, es sei besser, wenn Schweitzer Nächstenliebe übe, statt ein problematischer Theologe zu sein. Manche sprachen Schweitzer sogar ab, ein Christ zu sein. Da widerspricht Raphael Zager energisch: „Spätestens an Schweitzers Lebensführung zeigt sich, wie abwegig es ist, ihm das Christsein abzusprechen … Schweitzer stellte sein Leben ganz bewusst in die Nachfolge Jesu.“
Wurde seine Theologie oft ignoriert, so galt dies nicht für seine Ethik und Kulturphilosophie, die heute so aktuell wie nie sei. Aber auch seine damals kontroversen theologischen Thesen hätten sich inzwischen weitgehend durchgesetzt. Ihm wurden auch Lehrstühle angeboten (die er stets ablehnte) und acht Ehrendoktortitel verliehen, darunter von den Universitäten in Oxford, Tübingen und Marburg. Anhand von fünf Theologen exemplifizierte Zager die Rezeption Schweitzers.
Martin Werner schätzte Schweitzers konsequent historisch-kritisches und rationalistisches Denken. Er entschied sich für Schweitzer und gegen Barth. Werner akzeptierte auch Schweitzers These, dass sich Jesus in seiner Naherwartung geirrt habe. Dass auch die frühe Kirche sich mit der Parusieverzögerung irrte, nahm Werner zum Anlass, sich gegen die kirchliche Dogmatik zu entscheiden und sich auf die Ethik Jesu zurückzubesinnen.
Ulrich Neuenschwander schätzte an Schweitzer das Verschmelzen von Denken und Tat, von Glauben und Denken, von Philosophie und Religion. Neuenschwander hob hervor, dass der „Wille“ der zentrale philosophische Begriff Schweitzers sei.
Erich Gräßer sah Schweitzer als Außenseiter im theologischen Wissenschaftsbetrieb, würdigte aber dessen Eintreten für die historische Forschung, die drängende Frage nach der Eschatologie sowie seine Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben.
Auch Andreas Rössler betonte die Zusammengehörigkeit von Religion und Denken bei Schweitzer und würdigte vor allem dessen Wahrhaftigkeit im Hinblick auf aufzugebende Dogmen (etwa die Sühnopfertheologie).
Zum Schluss befasste sich der Referent mit Dorothea und Werner Zager, die sich in ihrem Buch „Albert Schweitzer – Impulse für eine wahrhaftiges Christentum“ vor allem für eine verständliche theologische Sprache aussprechen. Schweitzer schrieb: „Was vor allem nottut, ist, dass die Theologie eine klare Sprache rede.“ Schweitzer sei zeitlebens ein leidenschaftlicher Prediger und einfühlsamer Seelsorger gewesen. Schließlich gelte es, so Raphael Zager, „mit allen Christinnen und Christen gemeinsam nach Wegen zu suchen, wie ein wahrhaftiger Glaube im Sinne Schweitzers heute gelebt werden kann“.
Am Samstagabend fand – wie bei den Jahrestagungen des Bundes üblich – die Mitgliederversammlung statt, bei der die Geschäftsführung und der Vorstand entlastet und auch die Themen der zukünftigen Tagungen diskutiert wurden. Es gab auch Hinweise auf die Publikationen des Bundes: Die Zeitschrift, der elektronische Newsletter, der Facebook-Auftritt, die gelegentlich erscheinenden Forum-Hefte (das letzte über Albert Schweitzer) sowie die alljährlich erscheinenden Tagungsbände.
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung wurde ein Dokumentarfilm über Albert Schweitzer gezeigt, der allen Teilnehmern einen lebhaften Eindruck von der Arbeit des Urwaldarztes in Lambarene vermittelte.
Den Gottesdienst am Sonntagmorgen leitete Pfarrerin Dorothea Zager, die mit einer Überraschung aufwartete: dem Gast Albert Schweitzer (alias Werner Zager) stellte sie eine Reihe von kritischen Fragen, die dieser mit Worten aus seiner Morgenpredigt vom Sonntag, 18. Dezember 1904 in St. Nicolai beantwortete.
Als Credo wurde das Ringstedter Glaubensbekenntnis gemeinsam gesprochen, und die gesammelten Spenden in Höhe von 530 Euro wurden für das Krankenhaus in Lambarene bestimmt.
Den letzten Vortrag der Tagung hielt am Sonntagvormittag Prof. Dr. Werner Zager, Präsident des Bundes, zum Thema „Albert Schweitzer und der Bund für Freies Christentum“. Er begann mit dem Hinweis, dass Schweitzer mit dem 1948 gegründeten Bund von Anfang an in guter Verbindung stand und mit dessen Vorstandsmitgliedern einen regen brieflichen Austausch pflegte. Zager stellte dar, in welchem Verhältnis die Theologen des Bundes zu Schweitzer standen, welche Gedanken und Positionen sie mit ihm teilten und wo sie gegebenenfalls eigene Wege beschritten. Er wies auch darauf hin, dass diese Tagung in Bad Herrenalb bereits die dritte Tagung zu Albert Schweitzer sei (die erste fand 2004 und die letzte 2020 in Pforzheim statt). Namentlich erwähnte Zager die folgenden Personen, die wegen ihres Zusammenhangs mit dem Bund hier ausführlicher dargestellt werden:
Friedrich Heiler, Professor für Religionsgeschichte und Religionsphilosophie in Marburg, hatte ein Jahr vor Schweitzer in Schweden Vorträge gehalten, weshalb Schweitzer 1920 nach seinem Schwedenaufenthalt ihn in Marburg besuchte, wo er auch mit seinem Straßburger Lehrer Karl Budde sowie mit Martin Rade, dem Herausgeber der „Christlichen Welt“, zusammentraf. Noch im selben Jahr schrieb Heiler an Schweitzer: „Ich würde ja sehnlichst wünschen, dass Sie als Professor für Neues Testament an eine deutsche Universität gingen.“ Doch der vakante Lehrstuhl für Neues Testament in Marburg wurde nicht von Schweitzer, sondern 1921 von Rudolf Bultmann übernommen. Heiler wurde Gründungsmitglied des Bundes und wirkte über viele Jahre in dessen Vorstand mit.
Auch mit Heinrich Frick stand Schweitzer in Verbindung. Frick wurde 1929 Nachfolger von Rudolf Otto in Marburg und bot Schweitzer an, sein Nachfolger als Ordinarius für Systematische Theologie in Gießen zu werden: „Wenn eine Aussicht bestünde, Sie hierher zu verlocken, so wäre niemand glücklicher als ich.“ Doch Schweitzer lehnte ab. „Die Sehnsucht zu lehren ist immer lebendig, fast schmerzhaft lebendig in mir.“ Er fühlte sich dem ärztlichen Missionswerk verpflichtet. „Das ist meine Lebensaufgabe.“ Als die Universität Marburg 1952 ihre 425-Jahrfeier beging, bat Frick Schweitzer, die Festrede zu halten. „Unsere Universität könnte sich keinen besseren Mittelpunkt denken als den lebendigen Verkündiger des christlich-humanen Geistes, aus dem heraus unsere Universität 1527 … gegründet worden ist.“ Doch wieder musste Schweitzer absagen.
Theodor Siegfried, der damalige Dekan der Marburger Theologischen Fakultät, war 1933 an der Gründung des „Bundes für entschiedenen Protestantismus“ beteiligt und wollte Schweitzer für dessen Präsidentschaft gewinnen. „Ihres Ratschlages bedürfen wir in dieser Zeit ganz besonders“, schrieb er an Schweitzer, der auch diesen Wunsch abschlägig beschied. 1947 organisierte Siegfried zusammen mit Frick die Marburger Theologische Konferenz zum Thema „Christlicher Humanismus“, zu der er Schweitzer als Referent einlud. 1952 verlieh Marburg ihm die Ehrendoktorwürde. Und Siegfried schrieb: „Nun hoffen wir von ganzem Herzen, dass wir nach Ihrer Rückkehr aus Afrika Sie bei uns begrüßen dürfen.“
Pfarrer Erich Meyer lud 1948 zum ersten „Deutschen Kongress für Freies Christentum“ nach Frankfurt am Main ein und bat Schweitzer, daran teilzunehmen. Auch wenn dieser wieder absagen musste, verfolgte er den Kongress und alle nachfolgenden Tagungen des nun gegründeten „[Deutschen] Bundes für Freies Christentum“ mit lebhaftem Interesse. Unter dem Vorsitz von Meyer bot der neu gegründete Bund dem Urwaldarzt die Ehrenpräsidentschaft an, die er wegen seiner Verpflichtungen aber nicht annahm. Als Schweitzer 1951 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels von Theodor Heuss verliehen wurde, trafen sich Vertreter des Bundes am Abend mit Schweitzer, der ihnen versicherte, wie sehr er sich innerlich mit dem Bund verbunden fühlte. Schweitzer erkundigte sich nach theologischen Entwicklungen, insbesondere im Hinblick auf Rudolf Bultmann und die Dialektische Theologie um Karl Barth.
Zu den Theologen, die bei diesem Treffen auch dabei waren, gehörte Hans Pribnow, der die Schriftleitung der Zeitschrift „Freies Christentum“ übernommen hatte. An ihn schrieb Schweitzer: „Jede Nummer des Freien Christentums lese ich mit großem Interesse. Sie treffen in allem den richtigen Ton. Wie gerne würde ich auch von Zeit zu Zeit etwas beisteuern.“ In einem Brief kurz vor Schweitzers Geburtstag 1959 schrieb Pribnow nach Lambarene: „Meine (zumeist prächtigen) Konfirmanden lieben Sie alle sehr, für sie darf ich Ihnen bitte auch gratulieren.“ Pribnow hatte sich Schweitzers Theologie und Philosophie „vorbehaltlos zu eigen gemacht“, so Zager. Für ihn war Schweitzer aber noch mehr als der Theologe. „Sie sind gleichzeitig predigender Theologe, praktizierender Mediziner, ausübender Musiker. Und Sie sind Maurer, Dachdecker, Schreiner, Gärtner.“ 1964 gab Pribnow eine Schrift als Dankesgabe zu Ehren von Schweitzer heraus (es war das 50. Heft der Schriftenreihe „Freies Christentum“) und schrieb dazu: „Entscheidendes und Unwiderlegbares, Hilfreiches und Unentbehrliches“ habe Schweitzer erarbeitet, „um Jesus zu erkennen und zu verstehen. Mehr und sehr viel mehr noch: um als Mensch der Gegenwart mit Jesus verbunden sein zu können.“
Julius Richter, ein weiteres Gründungsmitglied des Bundes, lernte Schweitzer erst 1955 persönlich kennen und würdigte ihn als theologischen Forscher und Denker, „der mit unbeirrbarem Wahrheitsmut, unbekümmert um alle bisherigen äußeren Bindungen an Bibel und Dogma, der Forschung, besonders der Leben-Jesu-Forschung, neue Bahnen gebrochen und neue Wege gewiesen“ habe. Er hob vor allem den Dienst Schweitzers hervor, der auch der Dienst Jesu gewesen sei. „Wichtiger als alles Theologische ist mir, wie Ihnen selber, die Verwirklichung der Nachfolge Christi in Ihrem Tun und Leben geworden ist.“ Obwohl Schweitzer die anfänglich an ihn herangetragene Ehrenpräsidentschaft abgelehnt hatte, wurde er immer wieder als Ehrenpräsident bezeichnet, und Schweitzer ließ es sich offenbar gefallen.
Der Hamburger Theologe und Religionsphilosoph Kurt Leese gehörte ebenfalls zu den Gründungsmitgliedern des Bundes. Er hatte bei Schweitzer in Straßburg studiert und hielt immer wieder Kontakt zu ihm. Paul Tillich hat Leese als den „Erben der deutschen liberalen Theologie“ bezeichnet. Schweitzer hatte Leese das „Du“ angeboten „Ich gedenke Deiner häufig in großer Liebe und immerwährender Anhänglichkeit“, schrieb Leese an Schweitzer. Er scheute sich aber auch nicht, Kritik an Schweitzer zu üben. Vor allem tat er sich schwer mit Schweitzers Behauptung, Jesu Ethik der Liebe sei „denknotwendig“. „Dieser Rationalismus hat mich an Schweitzer von jeher befremdet“, schrieb er.
Heinz Röhr, Frankfurter Professor für Kirchengeschichte und Vergleichende Religionswissenschaft, stellte fest, dass afrikanische Studenten, die nach Deutschland kamen, kaum etwas über Schweitzer wussten. – Werner Zager kam am Ende seines Vortrags zu dem Schluss, dass Schweitzer vom Bund als theologischer Denker und Forscher anerkannt wurde, dass er für sein freies und undogmatisches Christentum sowie für seine Leben-Jesu-Forschung hochgeschätzt wurde, dass man seine aufopfernde Arbeit in Lambarene zu würdigen wusste und dass er nicht nur die kranken Afrikaner, sondern auch die seelische Krankheit des deutschen Volkes zu heilen vermochte.
Zager resümierte: „Der Bund für Freies Christentum ist seinem Ehrenpräsidenten in großer Hochachtung, Bewunderung und Liebe verbunden.“
Nach einigen Rückfragen zu Werner Zagers Vortrag kam es zu einer abschließenden Diskussion, die Studienleiter Peter Schock leitete. Insgesamt war es wieder eine gelungene Tagung in einem schönen Ambiente in einer in vieler Hinsicht angenehmen Tagungsstätte, zu der man bei einer der nächsten Jahrestagungen gerne wieder zurückkehren möchte.
Bericht: Dr. Kurt Bangert
Fotos: Dorothea und Dr. Raphael Zager
„Albert Schweitzer Denkmal Weimar“© Ad Meskens / Wikimedia Commons
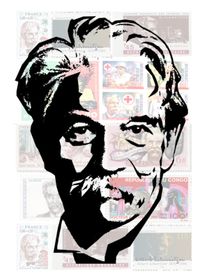

.jpg/picture-200?_=19981991b02)
.jpg/picture-200?_=19981977ee0)

.jpg/picture-200?_=199819949ea)
.jpg/picture-200?_=1998198354f)
.jpg/picture-200?_=1998198df51)
.jpeg/picture-200?_=1998118bc50)




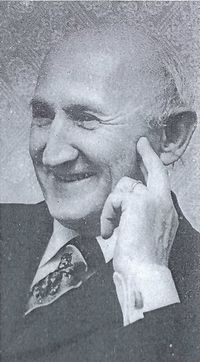


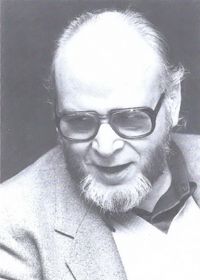

.jpg/picture-200?_=19981a692ae)