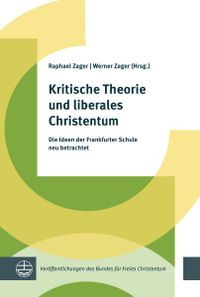Der neue Tagungsband
Wie von jeder Tagung hat der Bund für Freies Christentum auch von der vergangenen Tagung einen Band herausgegeben, in dem alle Vorträge und die Predigt unseres sonntäglichen Gottesdienstes nachzulesen sind.
Der aktuelle Tagungsband heißt:
Kritische Theorie
und liberales Christentum
Lesen Sie hier eine Rezension unseres Vorstandsmitgliedes Dr. Michael Großmann:
Im vergangenen Jahr konnte das Frankfurter Institut für Sozialforschung sein hundertjähriges Jubiläum feiern. Das nahm sich unser Bund zum Anlass, seine Jahrestagung der Kritischen Theorie zu widmen. Kritische Theorie versteht sich als eine Theorie der Gesellschaft, die von aufklärerischem Interesse geleitet ist. Doch sie öffnet zugleich die Augen – siehe Adornos und Horkheimers Klassiker Dialektik der Aufklärung – für die Gefahr, dass Aufklärung in ihr Gegenteil umschlägt. Auch ein liberales Christentum ist von Vernunft und Aufklärung inspiriert. Bieten sich angesichts dieser Schnittmenge Anknüpfungspunkte für ein Gespräch? Dieser Frage waren die Vorträge, Andachten und Diskussionen unserer Tagung gewidmet. Nun liegen die Beiträge in Buchform vor – ergänzt durch zwei weitere Aufsätze.
Eberhard Martin Pausch fragt in seinem Aufsatz Auf dem Weg zu einer Aufklärung 3.0 nach Erbe und Verheißung der Frankfurter Schule. Dabei betrachtet er gerade die frühen Vertreter der Frankfurter Schule durchaus kritisch – zum Beispiel in ihrem allzu lässigen Umgang mit philosophischer Logik. Dennoch sieht er für die gegenwärtige Ausformung der Kritischen Theorie Potenzial für eine Verständigung mit anderen philosophischen Strömungen, wenn es darum geht, die politische Praxis etwa durch Bildungsprozesse zu gestalten.
Klaus Viertbauer befasst sich mit den Möglichkeiten und Grenzen der Religion in einer „postsäkularen“ Gesellschaft. Mit Blick auf Jürgen Habermas spielt er am konkreten Beispiel der Präimplantationsdiagnostik durch, wie Kirchen bzw. Glaubensgemeinschaften in den Prozess der Normenbegründung einbezogen werden können. Viertbauer gesteht zu, dass – z.B. durch Übersetzung religiöser in säkulare Sprache – eine Kooperation möglich ist. Eine Leerstelle macht er jedoch angesichts von Habermas‘ Konzentration auf das Christentum aus: Der Verfasser kommt zu dem überzeugenden Schluss, dass das Programm einer postsäkularen Gesellschaft nur dann zukunftsweisend ist, wenn es gelingt, auch die Muslime in das Gespräch einzubeziehen.
Werner Zager und Michael Großmann gehen in ihren Beiträgen der Frage nach, ob die Aufklärung der Vernunft zu viel zugetraut hat. Aus theologischer Perspektive zeichnet Zager ein differenziertes Bild: Einerseits habe die Aufklärung „die Beharrungskräfte und Widerstände unmündigen Verhaltens unterschätzt“ (S. 81). Andererseits verweist der Verfasser auf die Verankerung der Vernunft in Erziehungsprozessen. Seinem Resümee ist unbedingt zuzustimmen: „Wenn die Aufklärung nicht scheitern soll, darf sie nicht zu einer ethischen Überforderung führen. Sie braucht eine Hoffnungsperspektive, wie sie der Glaube an Gott gewährt.“ (S. 82) Großmann betrachtet die Frage nach der Wirkmacht der Aufklärung in (geschichts-)philosophischer Sicht und kommt ähnlich wie Zager zunächst zu einer Antwort des „Sowohl – als auch“: Die Geschichte schlägt mal in diese, mal in jene Richtung aus. Der Ausblick in die Zukunft fällt beim Verfasser allerdings pessimistisch aus. Retten kann uns laut Großmann (mit Blick auf das Ende der Odyssee) nur eine „gegen alle Wahrscheinlichkeit wirkmächtige Liebe“ (S. 100).
Braucht eine liberale demokratische Gesellschaft ein liberales Christentum bzw. eine liberale Religion? Dieser Frage geht Raphael Zager nach. Wie Klaus Viertbauer setzt sich auch Zager vor allem mit Jürgen Habermas‘ Denken auseinander. Der Verfasser beantwortet die titelgebende Frage seines Beitrages mit einem klaren Ja. Laut Zager (der hier auf einer Linie mit Habermas liegt) benötigt eine Demokratie die Kooperation mit den Religionen. Allerdings – und das ist entscheidend – darf es sich hierbei nicht um fundamentalistische Strömungen handeln, die auf absoluten, von Vernunft nicht zu erreichenden Wahrheitsansprüchen beharren. Anschlussfähig ist nur eine Religion, die den Pluralismus moderner Gesellschaften akzeptiert und bereit ist zu einem echten Gespräch auf rationaler Grundlage (vgl. S. 121).
Kommunikative versus Kritische Vernunft. Beiden philosophischen Paradigmen lassen sich zentrale Figuren zuordnen: Während erstere am prominentesten durch den bereits erwähnten Jürgen Habermas vertreten wird, steht für letztere Hans Albert. Wolfgang Pfüller beleuchtet in seinem Aufsatz Gemeinsamkeiten und Unterschiede, aber auch Stärken und Schwächen beider Ansätze. Oben wurde bereits angedeutet, inwiefern laut Habermas Religion eine wichtige Rolle in einer modernen Gesellschaft zu spielen vermag. Pfüller zeigt nun, dass auch Albert in gewissen Grenzen offen für Religion ist – im Wesentlichen in ethischer Hinsicht. Die Heilsperspektive der Religion jedoch wird durch das Prinzip, alles kritisch zu prüfen, nicht erreicht.
„Die falschen Götzen macht zu Spott!“: Diese Zeile aus Johann Jacob Schütz‘ Kirchenlied Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut hat Andreas Rössler zum Titel seines Beitrages gemacht. Er stellt den Sinn des biblischen Bilderverbotes dar und warnt davor, Innerweltliches absolut zu setzen. Mit einer affirmativen Theologie – so der Verfasser – muss stets auch eine negative Theologie einhergehen: Letztere „macht, die Rätselhaftigkeit und Verborgenheit des Göttlichen deutlich, während die affirmative Theologie angesichts unserer Grenzen zu Bescheidenheit und Selbstkritik mahnt und um die Zweifel weiß, die auch bei der Glaubensgewissheit nicht ausbleiben“ (S. 180).
Abgerundet wird der Band durch zwei Beiträge, die dem liturgischen Rahmen der Tagung zuzuordnen sind. Unter dem Titel Vertrauensvolles Misstrauen haben Pfarrerin Dagmar Gruß und Pfarrer Ingo Zöllich eine Andacht als Dialog gestaltet. Das Thema lässt bereits erahnen, dass es um die kontroverse Diskussion entscheidender Fragen geht: Läuft die Kritische Theorie nicht Gefahr, allzu misstrauisch gegenüber politischen und gesellschaftlichen Institutionen zu werden? Sind aber nicht umgekehrt gerade in der Gegenwart Wachsamkeit und Vorsicht geboten? Und wo ist in diesem Spannungsfeld eigentlich der christliche Glaube einzuordnen? Gruß und Zöllich gelingt es, in klarer Sprache das Spannungsfeld abzustecken, in dem sich ein verantwortungsbewusster Glaube bewegen muss.
Der Abschlussgottesdienst der Jahrestagung fand am Michaelistag statt. Und den Tagungsband schließt die Predigt ab, die Dagmar Gruß im Rahmen dieses Gottesdienstes gehalten hat. Engelsworte ohne den Jargon der Eigentlichkeit:
Unter diesem Titel meditiert Gruß z.B. über Paul Klees Bild Angelus Novus. Walter Benjamin (er hatte das Gemälde gekauft) identifizierte die dargestellte Figur mit dem „Engel der Geschichte“, der auf all den Schrecken und das Unrecht zurückblickt. Die Predigt endet mit Worten, die sich hervorragend als Fazit des Tagungsbandes, aber auch als Geleit für unser zukünftiges Engagement eignen: „Wir haben noch viel zu tun. Denn wir sollen den Segen weitergeben und nicht die verfluchen, die nichts haben und auch überleben wollen. Für sie ist nichts mehr sehr gut. Solange wir ihretwegen das Bestehende kritisch beleuchten müssen, steht der Engel schweigend mit dem Schwert vor der Tür zum Friedensreich.“
Der Blick in die jeweiligen Aufsätze konnte hoffentlich zeigen:
Ein sowohl in seiner Komplexität als auch in seiner Bedeutung gewichtiges Thema wird in dem Buch von vielen Seiten beleuchtet. Manche Beiträge sind komplexer, manche sind einfacher zu lesen, sodass für jeden Anspruch und für jeden Bedarf etwas dabei ist. Die Aufsätze des Bandes zeigen: Glaube kommt um die Beschäftigung mit den konkreten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht herum.
Michael Großmann